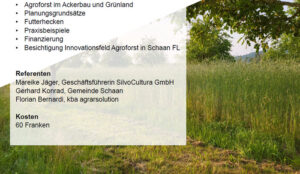Text von www.bietigheimerzeitung.de:
Im Wurmberg realisiert Isabel Gil in zwei Weinbergen ein Projekt der Permakultur. Es ist ein Ansatz gegen den Verfall der Steillagen.
Wer Isabel Gil durch die steilen Staffeln ihres Weinbergs am Besigheimer Wurmberg folgen will, muss sich beeilen und sollte gut in Form sein. Energisch stapft die 47-jährige Hessigheimerin in ihren Straßenstiefeln über die wackligen Stufen voran. Nach Begleitern schaut sie sich nur selten um.
Mit dieser Energie hat sie in den vergangenen beiden Jahren ihre beiden rund 30 Ar großen Weinberge auf neue Füße gestellt. Zwischen den Terrassen mit Wein, den immer größer werdenden Brachen und den Abschnitten mit Hecken und verwilderten Rebstöcken fallen diese Wengert ins Auge. Robinienstämme grenzen die Weinbergstaffeln gegen die Straße ab. Dahinter ist eine Reihe von Olivenbäumen erkennbar. Auf den Stock geschnittene Reben mit frischen Trieben stehen in Reih und Glied über blühendem Lavendel.
Ein Projekt der Permakultur
Es ist ein Projekt der Permakultur, der dauerhaften und nachhaltigen Landwirtschaft, das Isabel Gil in den Steillagen verfolgt. Langfristige Nutzung, Verzicht auf Pflanzenschutz, Vielfalt statt Monokultur – das sind einige der Prinzipien der alternativen Bewirtschaftung, die Gil in ihren Weinbergen umsetzen möchte. Die Pflanzen sind so gewählt, dass sie sich gegenseitig schützen und den Boden nicht überfordern, erläutert sie.
Doch bis der Idealzustand erreicht ist, ist es noch ein weiter Weg. Die Olivenbäume wurden aus Spanien angeliefert. Sie sind mehr als 50 Jahre alt und mussten mit Hilfe von Kränen im Boden verankert werden. An ihren Wurzeln hat Gil Kakteen gesetzt, „sie versorgen die Bäume mit Mineralien“. Der Lavendel ringsum ist in Schafswolle eingepackt. „Das hält die Erde feucht und unterdrückt das Unkraut.“ Bodendeckende Pflanzen wurden gesetzt, um die Terrassen zu stabilisieren. Walderdbeeren stehen zwischen den Rebzeilen, daneben Weinberg-Schnittlauch.
Alles hat im System der Permakultur seine eigene Funktion. Wenn das erst einmal funktioniert „habe ich nur noch wenig Arbeit“, sagt Gil. Die Robinienstämme schützen die Olivenbäume und den Weinberg gegen die Windstöße der Autos von der Straße. Sie haben Löcher für Bienen. Winterroggen und Sonnenblumen haben geholfen, dem Boden Kupfer und Phosphat zu entziehen. Beides habe sich in den Jahren der Monokultur in der Erde angesammelt.
„Phytoremedation“ nennt Gil dieses naturnahe Verfahren zur Säuberung des Bodens. Selbst als Nacktschnecken einen Teil ihrer gerade erst veredelten Reben vernichteten, hat sie auf den Einsatz von Chemie verzichtet. Für sie sind die Schnecken ein Zeichen, „dass der Weinberg nicht im Gleichgewicht ist“.
Noch ist nicht daran zu denken, die ersten Weintrauben zu ernten. „Zuerst muss der Weinberg funktionieren“, sagt Gil. In zwei bis drei Jahren will sie soweit sein. Vorerst freut sie sich darüber, dass die Olivenbäume viele Früchte tragen, die sie einlegen möchte. Das ist nur ein kleiner Anfang. „Ein resilienter Weinberg hat mehrfachen Nutzen“, sagt sie. Neben Wein lassen sich auch Erdbeeren, Heilkräuter, Zwiebeln, Lavendel und Blumen verwerten. Das ferne Ziel ist ein „Boutique-Weingut“, in dem sie hochwertigen Wein ausbauen und vermarkten kann.
Viel Arbeit haben auch die Anträge auf Genehmigungen mit sich gebracht, die Gil beim Landratsamt einreichen musste. Olivenbäume im Neckartal, das war auch für die Naturschützer im Ludwigsburger Kreishaus etwas ganz Neues. Über das Projekt „Regionale Neckarschleifen“ hat die Behörde ihre Versuche finanziell gefördert.
Neuartige Bienenstöcke
Dazu zählen auch die fünf „Hiive“ im Weinberg. Das sind neuartige Bienenstöcke, die Baumhöhlen nachahmen und mit einer App überwacht werden können. Trotz der Förderung muss Gill draufzahlen: „Das ist ein teures Hobby.“ Dennoch will sie ihren Wirkungskreis noch erweitern und weitere Weinberge hinzunehmen. Ideen und neue Projekte hat sie im Überfluss. Vielleicht hilft ja ihr Ansatz, die jahrhundertealten Steillagen vor weiterem Verfall zu bewahren und eine neue Perspektive aufzuzeigen, hofft sie. „Wenn ich das alleine hinbekommen, könnte das auch ein größerer Betrieb schaffen.“ Denn die Trostlosigkeit, die manche Weinberge über dem Neckar mittlerweile ausstrahlen, ist auch ihr nicht entgangen.
Was sie wurmt: Obwohl die Wengerter immer mehr Flächen aufgeben, werde immer noch zu viel philosophiert, „und zu wenig gemacht“. Aus ihrer Sicht fehlt es an einem Gesamtkonzept. „Es muss richtig krachen, damit sich etwas ändert“, sagt sie. Damit sich aber wirklich etwas ändert, müssten wohl die Schäden noch viel sichtbarer werden.